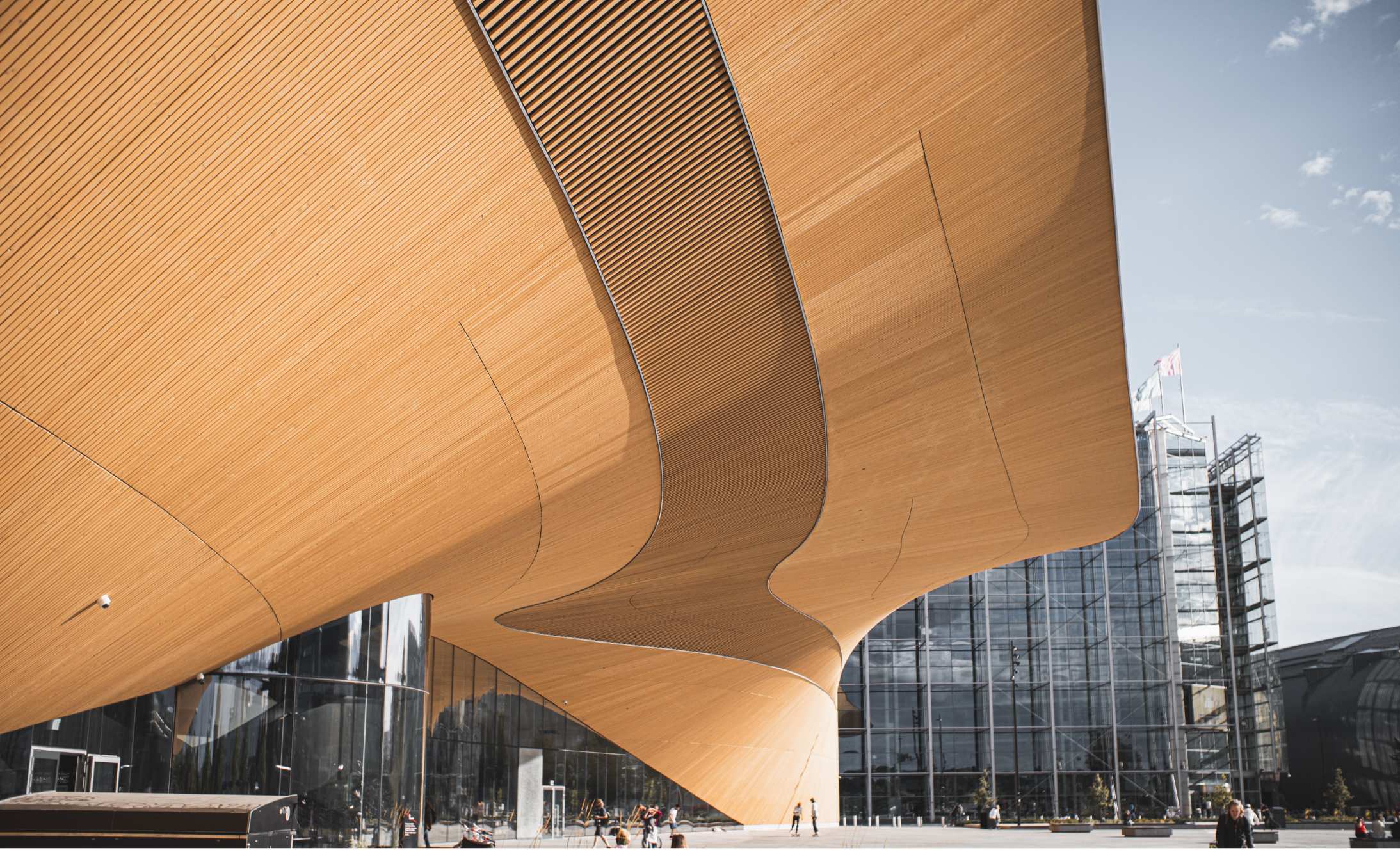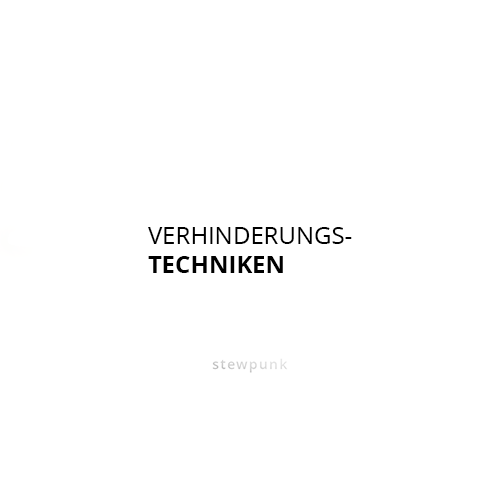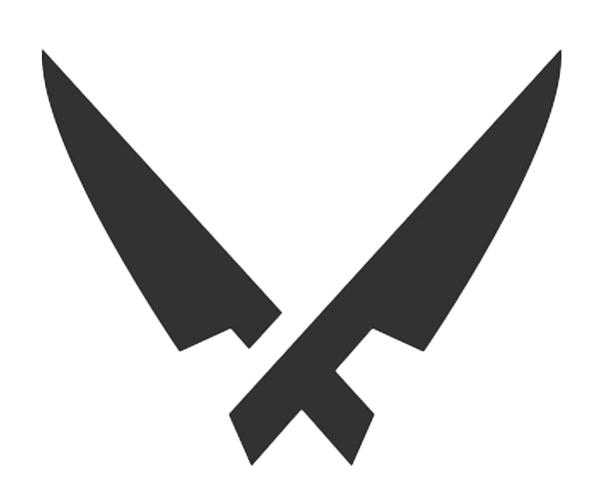- Muster: Veränderungsverweigerer verwenden häufig den Konjunktiv, um Ideen zu relativieren und zu entkräften.
- Typische Aussagen: „Man könnte das ja mal probieren, aber…“ – „Vielleicht wäre es theoretisch sinnvoll, wenn…“
- Kommunikationsebene: Die Aussagen bleiben stets vage, was als Kommunikationsstrategie dient, um sich nicht festzulegen. Dadurch entsteht keine Verpflichtung, die vorgeschlagenen Ideen umzusetzen.
Konjunktiv-Kommunikation: Die Kunst des Unverbindlichen
Tagtäglicher Anwendungsfall – Wenn Entscheidungen im Nebel verschwinden
In einem Projektmeeting zur Einführung einer neuen Marketingstrategie sitzen alle Teammitglieder gespannt zusammen. Du präsentierst konkrete Vorschläge, um die Reichweite in den sozialen Medien zu erhöhen. Nachdem du deine Ideen dargelegt hast, meldet sich Sarah zu Wort, eine Kollegin, die seit Jahren im Unternehmen ist: „Man könnte ja vielleicht überlegen, ob es sinnvoll wäre, in Erwägung zu ziehen, diese Ansätze eventuell weiterzuverfolgen.“
Die Aussage klingt auf den ersten Blick zustimmend, doch bei genauerem Hinhören merkst du, dass sie eigentlich nichts Konkretes sagt. Die restlichen Kollegen reagieren ähnlich vage: „Das wäre möglicherweise ein Ansatz.“ – „Vielleicht sollten wir das in Betracht ziehen.“ Am Ende des Meetings wurden viele Worte gewechselt, aber es wurden keine Entscheidungen getroffen, und niemand fühlt sich verantwortlich, die nächsten Schritte zu gehen.
Ziel und Zweck – Die Vermeidung von Verbindlichkeit
Konjunktiv-Kommunikation dient dazu, sich nicht festlegen zu müssen und Verantwortung zu vermeiden. Durch das Verwenden von unbestimmten Formulierungen und dem Konjunktiv („könnte“, „sollte“, „wäre“) bleiben Aussagen schwammig und unverbindlich. Sarah und die anderen möchten nicht klar Stellung beziehen, um mögliche Konsequenzen oder Verpflichtungen zu umgehen. Indem sie ihre Aussagen in Möglichkeitsformen hüllen, schaffen sie einen Raum, in dem jeder alles Mögliche interpretieren kann, ohne dass jemand zur Rechenschaft gezogen werden kann.
Kontext – Eine Kultur der Unsicherheit und Vorsicht
Dieses Kommunikationsmuster tritt häufig in Unternehmen auf, in denen Fehler bestraft werden und eine hohe Angst vor negativen Konsequenzen besteht. Mitarbeiter lernen, dass es sicherer ist, sich nicht eindeutig zu äußern, um nicht angreifbar zu sein. In solchen Umgebungen wird Klarheit mit Risiko gleichgesetzt. Zudem kann es in hierarchischen Strukturen vorkommen, wo Meinungen der Vorgesetzten nicht offen widersprochen wird, aber auch keine echte Zustimmung besteht. Der Konjunktiv bietet hier eine Möglichkeit, scheinbar mitzuwirken, ohne sich wirklich zu engagieren.
Der Schaden – Stillstand durch Unverbindlichkeit
Die Verwendung von Konjunktiv-Kommunikation führt dazu, dass Entscheidungen verzögert oder gar nicht getroffen werden. Projekte stagnieren, weil niemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Die Motivation im Team sinkt, da klare Ziele und Richtungen fehlen. Innovative Ideen verlieren an Schwung, weil sie in einem Meer aus vagen Formulierungen untergehen. Zudem entsteht ein Klima des Misstrauens, da niemand wirklich weiß, woran er bei den anderen ist. Die Effizienz leidet, und Chancen werden verpasst, weil die Umsetzung konkreter Maßnahmen ausbleibt.
Mögliche Lösungen – Klarheit schaffen und Verbindlichkeit fördern
Um der Konjunktiv-Kommunikation entgegenzuwirken, ist es wichtig, aktiv nach konkreten Aussagen und Entscheidungen zu fragen. In unserem Beispiel könntest du direkt auf Sarahs Beitrag eingehen: „Danke, Sarah. Bedeutet das, dass du dem Vorschlag zustimmst und bereit bist, an der Umsetzung mitzuwirken?“ Durch gezieltes Nachfragen forderst du Verbindlichkeit ein und bringst die Kollegen dazu, klare Positionen zu beziehen.
Eine weitere Möglichkeit ist, während des Meetings festzuhalten, welche konkreten Schritte als Nächstes unternommen werden sollen, und Verantwortlichkeiten zu verteilen. Zum Beispiel: „Wer ist bereit, den ersten Entwurf für die neue Social-Media-Kampagne zu erstellen?“ Durch das Einfordern von konkreten Aktionen verhinderst du, dass die Diskussion im Unverbindlichen verbleibt.
Es kann auch hilfreich sein, eine offene Feedback-Kultur zu etablieren, in der Mitarbeiter keine Angst vor Fehlern haben müssen. Wenn die Angst vor negativen Konsequenzen sinkt, sind die Kollegen eher bereit, klare Aussagen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.
Schließlich ist es wichtig, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Indem du in deiner Kommunikation auf den Konjunktiv verzichtest und klare, aktive Formulierungen verwendest, setzt du einen Standard und ermutigst andere, es dir gleichzutun.
Konjunktiv-Kommunikation: Beispielcase und Lösungsansatz
Unangemessenes Verhalten – Was gar nicht geht
Situation:
Im Marketing-Team wird über eine neue Kampagne diskutiert. Julia schlägt vor, vermehrt auf Social Media Influencer zu setzen, um die Marke bei jüngeren Zielgruppen bekannter zu machen. Thomas, ihr Kollege, antwortet:
„Man könnte das ja eventuell mal ausprobieren, aber vielleicht sollten wir doch lieber bei unseren bewährten Methoden bleiben. Es wäre ja möglich, dass das nicht so gut ankommt.“
Problematisch:
- Verwendet vage Formulierungen und den Konjunktiv, um sich nicht festzulegen.
- Verhindert klare Entscheidungen und Verantwortlichkeiten.
- Schafft Unsicherheit im Team durch Unverbindlichkeit.
- Bietet keine konkreten Vorschläge oder Standpunkte.
Angemessenes Verhalten – Wie man es machen sollte
Alternative Reaktion von Thomas:
„Julia, ich finde deinen Ansatz interessant und sehe das Potenzial, unsere Reichweite zu erhöhen. Allerdings habe ich Bedenken, ob unsere Zielgruppe über diese Influencer optimal erreicht wird. Können wir gemeinsam analysieren, welche Influencer am besten zu unserer Marke passen und welche Erfolgsbeispiele es bereits gibt?“
Positiv:
- Äußert seine Meinung klar und direkt.
- Bringt konkrete Bedenken ein, ohne abzuschwächen.
- Regt eine konstruktive Diskussion an und bietet Lösungen.
- Trägt zu einer effektiven Entscheidungsfindung bei.