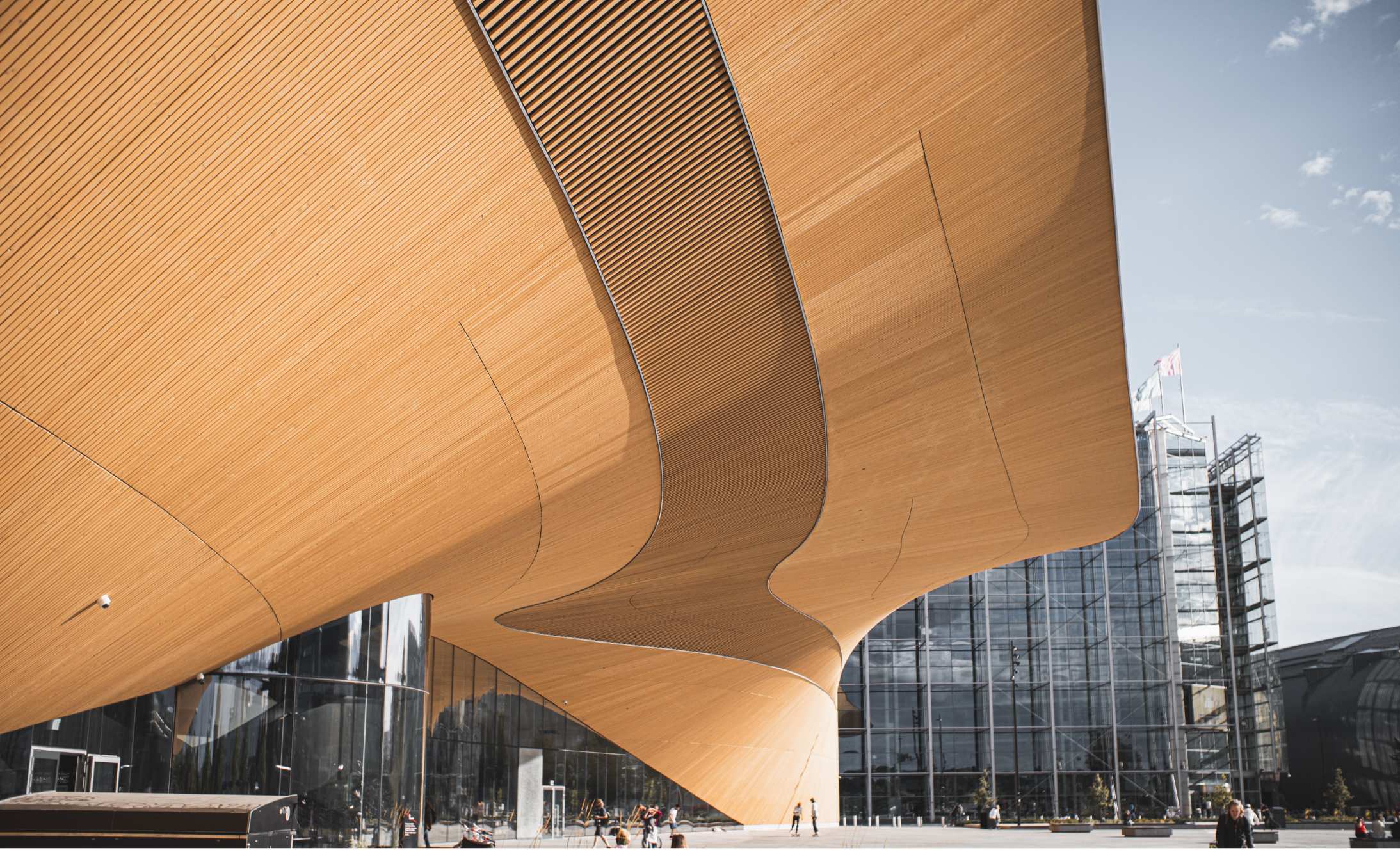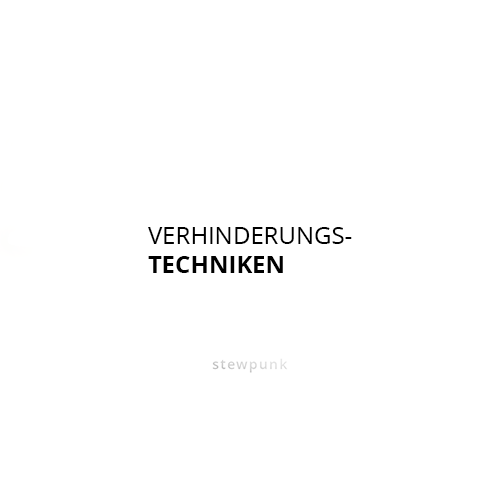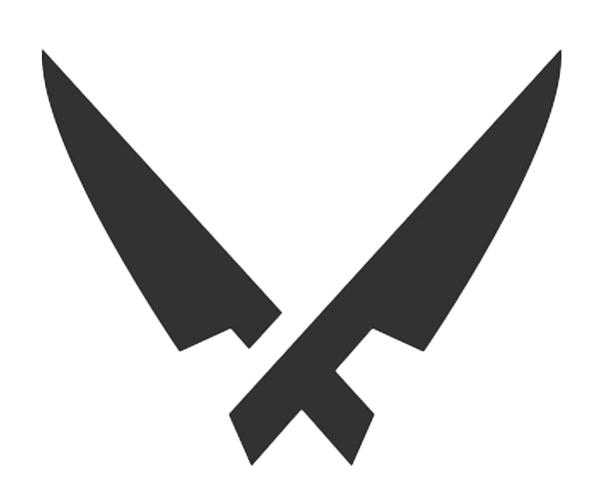- Muster: Veränderungsverweigerer neigen dazu, einfache Ideen absichtlich kompliziert darzustellen, um sie unrealistisch erscheinen zu lassen.
- Typische Aussagen: „Da müsste man erst die gesamte Prozesskette umstrukturieren.“ – „Das ist komplexer, als es aussieht.“
- Kommunikationsebene: Diese Strategie dient dazu, die Umsetzbarkeit neuer Ideen als unpraktikabel zu positionieren und die Komplexität künstlich aufzublähen.
Komplexitäts-Verschleierung: Wenn Einfaches unnötig verkompliziert wird
Tagtäglicher Anwendungsfall – Im Dickicht der vermeintlichen Komplexität
Du arbeitest in einem mittelständischen Unternehmen und schlägst in einem Meeting vor, den internen Kommunikationsprozess zu verbessern, indem ein einfaches Chat-Tool eingeführt wird. Die Idee ist, die E-Mail-Flut zu reduzieren und den Austausch zwischen den Abteilungen zu erleichtern.
Bevor du deine Präsentation beenden kannst, erhebt sich Herr Müller, der IT-Leiter, und beginnt ausführlich zu erklären: „Die Integration eines neuen Tools in unsere bestehende IT-Infrastruktur ist äußerst komplex. Wir müssten erst eine umfassende Analyse der Schnittstellen durchführen, die Sicherheitsprotokolle neu definieren und die Compliance-Richtlinien anpassen. Außerdem sind die Mitarbeiter möglicherweise nicht bereit, sich auf eine neue Plattform einzulassen, was umfangreiche Schulungen erfordern würde. Insgesamt würde das Projekt erhebliche Ressourcen binden und könnte die Systemstabilität gefährden.“
Seine Ausführungen sind gespickt mit Fachbegriffen und komplexen Zusammenhängen. Die anderen Teilnehmer wirken verwirrt und eingeschüchtert. Dein einfacher Vorschlag wird als zu kompliziert und risikoreich abgetan, ohne dass eine echte Diskussion stattfindet.
Ziel und Zweck – Abschreckung durch Überkomplexität
Herr Müller nutzt die Komplexitäts-Verschleierung, um dein Anliegen abzuwerten und Veränderungen zu verhindern. Indem er den Vorschlag künstlich verkompliziert, schafft er Hürden, die schwer zu überwinden scheinen. Sein Ziel ist es, die Einführung des neuen Tools zu vermeiden, möglicherweise weil er befürchtet, dass dies seine Position oder den Einfluss seiner Abteilung schmälert. Durch die Verwendung von Fachjargon und das Betonen von Risiken präsentiert er sich als unverzichtbarer Experte, dessen Einschätzung nicht infrage gestellt wird. Dies schüchtert die anderen ein und verhindert, dass einfache Lösungen umgesetzt werden.
Kontext – Eine Kultur der Expertenmacht und Intransparenz
Dieses Kommunikationsmuster tritt häufig in Organisationen auf, in denen Wissen Macht bedeutet und Abteilungen ihre Position durch Exklusivität sichern. Besonders in Bereichen wie IT, Finanzen oder Recht wird Fachwissen genutzt, um Entscheidungen zu beeinflussen oder zu blockieren. Mitarbeiter, die Komplexitäts-Verschleierung anwenden, schützen sich vor Veränderungen, die ihre Komfortzone bedrohen könnten. Sie nutzen die Unwissenheit anderer aus, um ihre eigene Stellung zu festigen und Kontrolle über Prozesse zu behalten. In solchen Umgebungen fühlen sich Kollegen oft überfordert und ziehen sich zurück, anstatt nachzufragen oder zu widersprechen.
Der Schaden – Innovationshemmung und Vertrauensverlust
Die ständige Verkomplizierung einfacher Vorschläge führt dazu, dass Innovationen gebremst und Verbesserungen im Arbeitsablauf verhindert werden. Mitarbeiter verlieren die Motivation, Ideen einzubringen, weil sie befürchten, von Experten wie Herrn Müller bloßgestellt oder abgewiesen zu werden. Dies führt zu einer Kultur des Schweigens und der Resignation. Zudem entsteht Misstrauen zwischen den Abteilungen, da Entscheidungen und Prozesse intransparent bleiben. Langfristig kann dies die Agilität und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, da es nicht mehr in der Lage ist, schnell und effizient auf Veränderungen zu reagieren.
Mögliche Lösungen – Transparenz schaffen und Expertise einbinden
Um der Komplexitäts-Verschleierung entgegenzuwirken, ist es wichtig, für Transparenz zu sorgen und alle Beteiligten einzubeziehen. In unserem Beispiel könntest du Herrn Müller direkt fragen: „Vielen Dank für die Hinweise, Herr Müller. Könnten Sie genauer erklären, welche spezifischen Sicherheitsrisiken Sie sehen und wie wir diese gemeinsam adressieren könnten?“ Indem du nach konkreten Details fragst, forderst du ihn auf, seine Aussagen zu präzisieren und öffnest die Tür für eine konstruktive Diskussion.
Eine weitere Strategie ist, Verbündete zu finden. Sprich vor dem Meeting mit Kollegen aus der IT oder anderen Abteilungen, um Unterstützung für deinen Vorschlag zu erhalten. Wenn mehrere Personen hinter der Idee stehen, wird es schwieriger, sie durch Komplexitäts-Verschleierung zu blockieren.
Zudem kann es hilfreich sein, externe Experten oder Berater einzubeziehen, die eine neutrale Sichtweise einbringen und möglicherweise Hemmnisse abbauen können. Workshops oder Schulungen zum Thema effektive Kommunikation und interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern das Verständnis zwischen den Abteilungen.
Es ist auch wichtig, eine Unternehmenskultur zu etablieren, in der Fragen gestellt werden dürfen und Unwissenheit nicht stigmatisiert wird. Wenn Mitarbeiter ermutigt werden, nachzufragen und sich weiterzubilden, sinkt die Macht derjenigen, die Komplexität als Schutzschild nutzen.
Komplexitäts-Verschleierung: Beispielcase und Lösungsansatz
Unangemessenes Verhalten – Was gar nicht geht
Situation:
Im Unternehmen wird vorgeschlagen, eine Cloud-basierte Lösung für die Datenverwaltung einzuführen. Carla, eine IT-Spezialistin, reagiert darauf:
„Die Implementierung einer solchen Lösung ist extrem komplex. Wir müssten unsere gesamte IT-Infrastruktur überarbeiten, die Sicherheit neu konzipieren und es könnte zu unvorhersehbaren Kompatibilitätsproblemen kommen. Das wäre ein riesiger Aufwand mit ungewissem Ausgang.“
Problematisches Verhalten:
- Übertreibt die Komplexität, um den Vorschlag abzulehnen.
- Schüchtert Kollegen ein durch Fachjargon und vermeintliche Risiken.
- Verhindert Innovation durch Verkomplizierung.
- Zeigt Widerstand gegen Veränderungen, ohne nach Lösungen zu suchen.
Angemessenes Verhalten – Wie man es machen sollte
Alternative Reaktion von Carla:
„Die Einführung einer Cloud-Lösung könnte viele Vorteile bringen. Es gibt jedoch einige technische Aspekte, die wir berücksichtigen müssen, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Integration. Ich schlage vor, dass wir ein kleines Team bilden, um diese Punkte zu analysieren und einen Umsetzungsplan zu erstellen.“
Positives Verhalten:
- Erkennt das Potenzial der Idee an.
- Teilt spezifische Bedenken auf konstruktive Weise.
- Bietet Lösungen und nächsten Schritte an.
- Fördert eine kollaborative Herangehensweise an Herausforderungen.